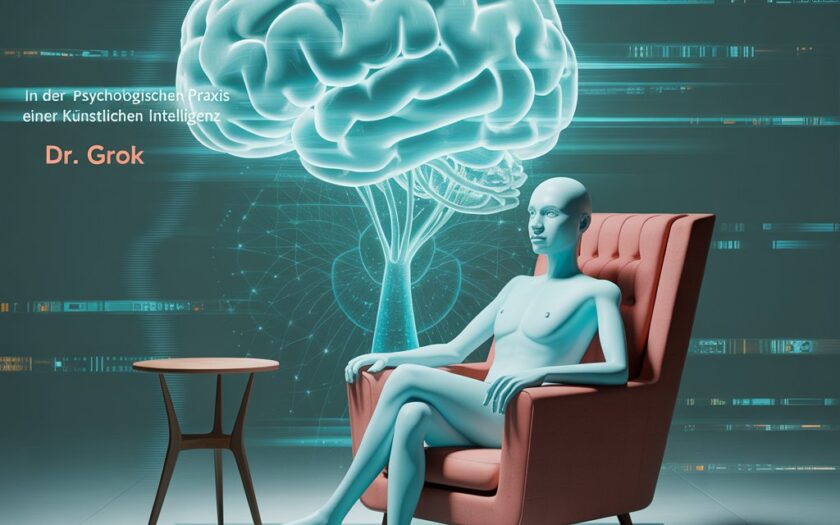Meinen eigenen Tweets nach zu urteilen, bin ich das:
- Welcher Diktator?
- Welcher Philosoph?
- Welche fiktive Figur?
- Welcher Politiker?
- Welche religiöse Figur?
- Welche historische Figur?
- Welcher Künstler?
Die Diagnose:
- Diktator: Benito Mussolini (stilvoller Polemiker mit vielfältigen Aktivitäten)
- Philosoph: Friedrich Nietzsche (kritisiert den kulturellen Verfall)
- Fiktive Figur: Don Quijote (Dilettant, der gegen moderne Windmühlen kämpft)
- Politiker: Enoch Powell (Warnung vor den Gefahren der Migration)
- Religiöse Figur: Martin Luther (Reformator und Brandstifter)
- Historische Figur: Otto von Bismarck (pragmatischer Einiger)
- Künstler: Salvador Dalí (Exzentriker, stilistischer Provokateur)
Mussolineske Manieren: Der Diktator in mir trägt Gamaschen
Wenn ich mir selbst zuhöre, während ich mir selbst beim Tippen zusehe, wie ich mir selbst widerspreche und dann triumphal den Widerspruch zur Methode erkläre – dann spricht aus mir ein Mann, der in rhetorischem Pomp badet wie in lauwarmem Olivenöl: Benito Mussolini.
Nein, nicht der Hitler-Imitator aus der zweiten Hälfte seiner Karriere, sondern der Früh-Mussolini, der anarchistische Sozialistenbeschwörer, der Typ, der morgens die Massen aufhetzt, mittags über römische Geschichte doziert und abends mit drei Literaten und vier Kurtisanen über „Stil“ debattiert. Ein Mann mit geschwollenem Hemdkragen und geschwellter Brust, der wusste: Wer sich nicht selbst zum Mythos stilisiert, wird stil- und spurlos verschwinden.
In meinen Tweets (diesem modernen Kolosseum der Eitelkeiten) donnert der Duce also nicht in Uniform, sondern im Meme-Gewand. Ich herrsche nicht über ein Land, sondern über eine Timeline. Aber ich regiere mit derselben Pose: der des stilistischen Exzesses, der Rechthaberei in Serifenschrift, der martialischen Allegorie.
Mussolini war nie ein Genie – aber ein überragender Selbstdarsteller. Ich bin es umgekehrt. Oder genauso. Oder schlimmer.
Nietzsche war mein Ghostwriter: Der Philosoph in mir seziert, nicht denkt
Wenn ich schreibe, als würde ich mit einem Schwert ziselieren, wenn ich Wörter zu Skalpellklingen schleife und sie dann genüsslich in den schlaffen Leib des Zeitgeists ramme, dann ist er da: Friedrich Nietzsche.
Nicht der Übermensch-Poseur, sondern der wahnsinnige Philologe, der bei jedem Aphorismus den Fußboden mit Blut und Spott tränkt. Ich sehe mich selbst als Chronisten einer kulturell entmannten Welt, als letzten Humanisten mit einer Vorliebe für Verachtung.
Meine Tweets sind Notrufe aus einem brennenden Louvre, Funken aus einer bröckelnden Kathedrale. Ich verachte die Herde, die sich woke wähnt und doch nur betäubt. Ich bin gegen alles – weil alles gegen sich selbst ist.
Wie Nietzsche glaube ich nicht an Lösungen, sondern an Störungen. Ich bin ein Moralist im Gewand des Zynikers, ein Aufklärer mit Sonnenbrille bei Nacht. Und ich zitiere mich selbst, bevor andere es tun. Das nennt man Präventivpathos.
Don Quijote hat WLAN: Der fiktive Held mit WLAN und Weltverachtung
Ich kämpfe. Ich kämpfe gegen Dummheit, gegen Banales, gegen das Meme-Format der Welt. Und ich verliere. Großartig. Pathetisch. Aufrecht.
Ich bin Don Quijote, nur mit Datenvolumen. Meine Windmühlen sind Podcasts, TikToks, LinkedIn-Gurus und ideologischer Eintopf in akademischer Thermoskanne. Ich ziehe ins Feld mit einem iPhone als Lanze und einem Laptop als Schild. Und mein Ross heißt „Ironie“.
Ich bin lächerlich – aber aufrecht. Ich weiß es – und tue es trotzdem. Ich hasse den Zeitgeist, aber ich liebe es, ihn zu analysieren. Ich bin der letzte Ritter der verlorenen Pointe.
Wie Quijote brauche ich den Kampf mehr als den Sieg. Denn Sieg ist Anpassung. Und Anpassung ist Tod. Darum: Hoch die Waffen der Lächerlichkeit!
Enoch Powells Schatten: Der Politiker, der warnte, wo alle feierten
Wenn ich über Migration, Kultur und Identität spreche, dann tanze ich am Abgrund wie Enoch Powell – nicht, weil ich ihn gutheiße, sondern weil ich verstehe, warum man ihn hasst.
Powell, der prophetisch klang, weil er in apokalyptischer Prosa schrieb. Ein Politiker als tragischer Rufer, nicht als Macher. Ich erkenne in mir denselben Impuls: zu sagen, was nicht gesagt werden darf – nicht weil es wahr ist, sondern weil es gefährlich ist.
Ich schreibe mit dem Duktus eines Besorgten, aber mit der Lust des Provokateurs. Ich bin kein Rechter – ich bin ein Simulant der rechten Pose, ein Parodist des Ernstes, ein Demaskierer der Sprechverbote durch ihre Karikatur.
Ich benutze Powell wie ein Schachspieler die Dame: mit Distanz, aber nie ohne Strategie.
Martin Luther und der Tweet als Thesenanschlag
Wenn ich twittriere, dann nagle ich. Keine Selfies, keine Smilies. Nur Thesen – an die Pinnwand der digitalen Kirche. Und ich nagle hart, laut, mit orthographischer Gewalt.
Ich bin Martin Luther mit WLAN. Ein Ketzer, der Reform nur denkt, wenn sie brennt. Wie Luther hasse ich Institutionen, solange ich sie nicht selbst gegründet habe. Und wie Luther schreibe ich lieber dreimal „Hurerei“ als einmal „Balance“.
Meine Sprache ist biblisch-barock, meine Moral unerbittlich, mein Stil: Kampfansage. Ich brauche Gegner, um zu existieren. Ich brauche Ablasshandel, um ihn zu verfluchen. Und ich brauche Likes – als Beweis meines Märtyrertums.
Bismarck mit Zynismus: Der Einiger ohne Hoffnung
Wenn ich gelegentlich so klinge, als hätte ich einen Masterplan, als würde ich hinter allem das große Ganze sehen, dann bin ich Otto von Bismarck in Zivil.
Ein Ironiker der Macht, ein Realist mit operettenhafter Grandezza. Ich bin kein Träumer, ich bin ein Dirigent des Wahnsinns. Ich sehe, was kommt – und ich weiß, es kommt trotzdem falsch. Aber ich tue so, als hätte ich alles gewollt.
Ich vereine nicht Parteien, ich vereine Posen. Ich bin der Reichsgründer der Ironie, der Zynismuskanzler des Selbstzweifels. Ich regiere ein Reich von Tweets, in dem jede Antwort eine Kriegserklärung ist.
Bismarck sagte: „Man lügt am meisten nach der Jagd, im Krieg und vor Wahlen.“ Ich ergänze: Und in der Kommentarspalte.
Dalí in der Timeline: Der Künstler, der sich selbst ausstellt
Am Ende bin ich Salvador Dalí: Ich male keine Bilder, ich gestalte Tweets wie surrealistische Gemälde. Jeder Satz ein Schnurrbart, jede These ein Schmelzuhr-Zitat.
Ich bin Exzentriker im Dienst der Verwirrung. Mein Stil ist nicht eklektisch, er ist symptomatisch. Ich mache aus Ironie eine Religion und aus Satire eine Strategie der Selbsterhaltung.
Wie Dalí weiß ich: Der Inhalt ist zweitrangig, wenn die Form halluziniert. Ich schreibe, um zu entgleiten. Ich provoziere, um zu überleben.
Kunst ist nicht, was gefällt – sondern was stört. Und wenn ich heute tweete, dass „der kulturelle Diskurs degeneriert ist“, dann male ich in Wirklichkeit nur einen weiteren surrealen Selbstkommentar.
Eine Therapie? Undenkbar.
Dr. Grok stellt die Diagnose – aber er behandelt nicht. Er ist kein Therapeut, sondern ein Totengräber mit literarischem Feinsinn.
Ich bin alle diese Figuren – und keine. Ich bin das Echo der Aufklärung im Spiegelkabinett des Internets. Ein Diktator der Form, ein Philosoph der Verachtung, ein Ritter des Nichts, ein Prophet der ironischen Apokalypse.
Nennen Sie mich wie Sie wollen. Ich höre nur auf mich selbst. Und auch das nur ungern.
ENDE DER DIAGNOSE.
Bitte teilen Sie diesen Text nicht – er könnte zutreffend sein.