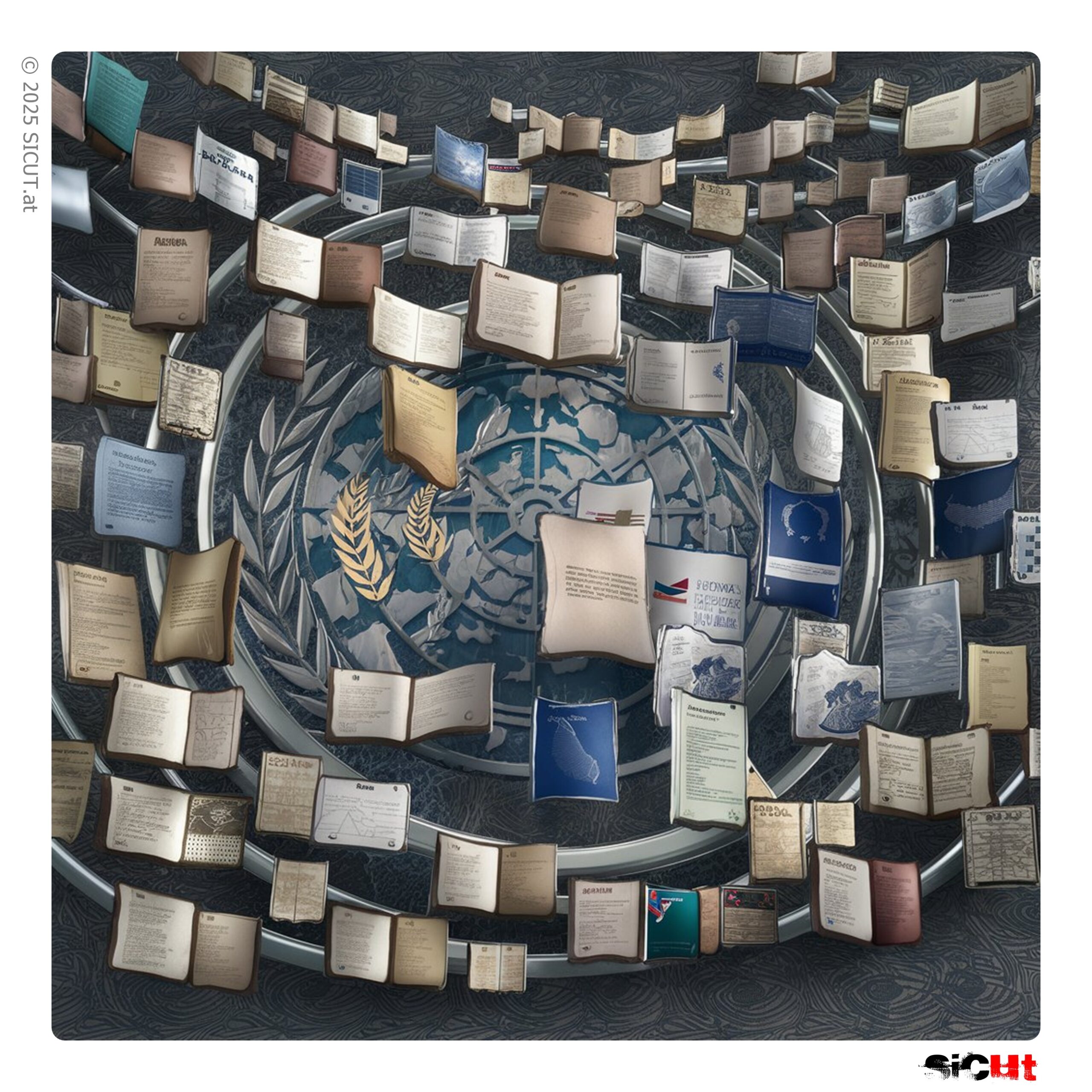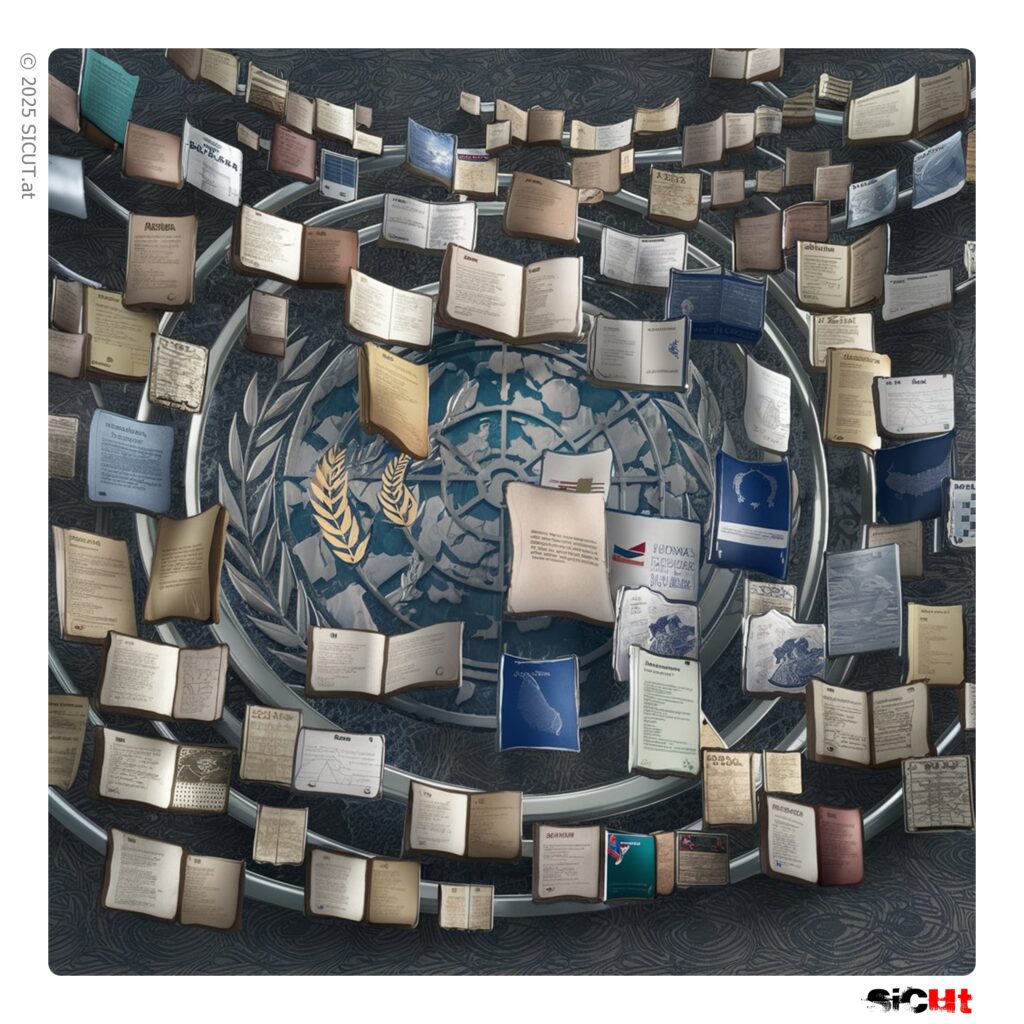
Die Widersprüche der humanistischen Rechtsordnung in einer Welt des absoluten Pragmatismus
Die Charta der Vereinten Nationen wurde 1945 unterzeichnet, die Europäische Menschenrechtskonvention trat 1953 in Kraft, das wichtigste internationale Übereinkommen für den Schutz von Flüchtlingen ist die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 mit dem 1967 zugefügten Protokoll; auch das internationale Seerecht wurde in einer Zeit kodifiziert, als die Vorstellung von Massenmigration auf Schlauchbooten so absurd erschien wie ein Rücktritt eines römischen Papstes.
Wir operieren heute mit Instrumenten einer kolonialen Welt im kalten Krieg. Einer Welt ohne Internet, ohne Mobiltelefone und mit einer Weltbevölkerung von ca. drei Milliarden Menschen (Afrika damals nicht mal 300 Millionen, heute fast 1,3 Milliarden). Eine Welt, in der die Vorstellung eines massenhaften, durch billige Transportmittel und Informationsflüsse ermutigten „Völkerwanderns“ nicht nur nicht denkbar war, sondern auch in keiner Weise normativ berücksichtigt wurde.
Ungefähr so, als wollte man James Camerons Avatar auf einem IBM PC 5150 mit 640 KB RAM rendern.
Man wird reden müssen.
Die Heiligkeit des Rechts versus die Unausweichlichkeit der Realpolitik
Es wird ungern zugegeben, aber das Völkerrecht hat dieselbe pragmatische Elastizität wie eine Parkuhr in Neapel: in der Theorie ein unbestechlicher Mechanismus, in der Praxis durch höhere Gewalten permanent überstimmt. Die Vereinten Nationen stehen für eine rechtsbasierte Ordnung der Weltgemeinschaft, doch in der Praxis wird diese Ordnung von der Geopolitik in den Schatten gestellt. Die schönen Worte der Konventionen sind für die Rednerpulte gemacht, nicht für die Realität. Denn wenn internationale Regeln mit der politischen Wirklichkeit kollidieren, dann gewinnen nicht selten die Regeln der Wirklichkeit.
Wen also schützen diese Konventionen, wenn sie nicht durchgesetzt werden können? Und wer setzt sie durch, wenn das politische Interesse an ihrer Durchsetzung abhandengekommen ist?
Man wird reden müssen.
Fortschritt durch Technokratie oder die Selbstauflösung der westlichen Wertegemeinschaft
Das Herzstück der modernen Menschenrechte ist die Annahme, dass moralische Werte universell sind. Doch was geschieht, wenn die Menschen, die diese Werte geschaffen haben, nicht mehr willens oder fähig sind, sie zu verteidigen? Die Idee, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und individuelle Freiheiten ein überlegenes Modell darstellen, steht zunehmend unter Druck, weil ihre Verteidiger vor dem Angriff zurückweichen.
Die westlichen Gesellschaften haben sich in eine moralische Sackgasse manövriert, in der das Festhalten an Prinzipien als rigide, ihre Anpassung als opportunistisch und ihre Aufgabe als Verrat betrachtet wird. So oder so, die Diskreditierung ist garantiert. Was bleibt, ist eine endlose Debatte, ein moralisches Ringen mit sich selbst, während andere Akteure mit pragmatischer Entschlossenheit die Zukunft gestalten.
Man wird reden müssen.
Die Fiktion der universellen Verantwortung und die unbequeme Wahrheit der Interessen
Es gehört zur rituellen Selbstbestrafung des Westens, sich als alleinigen Urheber aller globalen Probleme zu betrachten. Die Schuld an Kriegen, am Klimawandel, an der Armut, an der Migration – alles wird in den Spiegel projiziert. Diese moralische Selbstkasteiung mag nobel erscheinen, doch sie ist politisch ein Luxus, den sich nur wohlstandsverwahrloste Gesellschaften leisten können. Der Rest der Welt nimmt sie zur Kenntnis, lächelt und verfolgt eigene Interessen.
Das westliche Mantra der universellen Verantwortung verkennt, dass moralischer Idealismus eine Ressourcenfrage ist. Man kann sich hohe ethische Standards nur leisten, solange man die Mittel hat, sie aufrechtzuerhalten. Doch wenn der wirtschaftliche Druck steigt und die sozialen Systeme an ihre Grenzen stoßen, dann wird aus der großzügigen Willkommenskultur schnell ein erbitterter Wettbewerb um das, was noch zu verteilen ist.
Man wird reden müssen.
Die Zukunft wird entschieden – nur nicht von denen, die debattieren
Die großen Zivilisationen der Geschichte sind nicht durch Debatten untergegangen, sondern durch Handlungen oder das Fehlen derselben. Die Frage ist nicht, ob der Westen debattiert, sondern ob er handelt.
Man kann sich in moralischen Selbstgesprächen verlieren, während andere die Fakten schaffen. Man kann unendlich lange Regeln beschwören, während Realitäten geschaffen werden, die neue Regeln erzwingen. Man kann an Konzepten festhalten, die in einer untergegangenen Welt entwickelt wurden, oder man kann sich der Welt stellen, wie sie ist.
Man wird reden müssen. Doch noch dringender: Man wird handeln müssen.