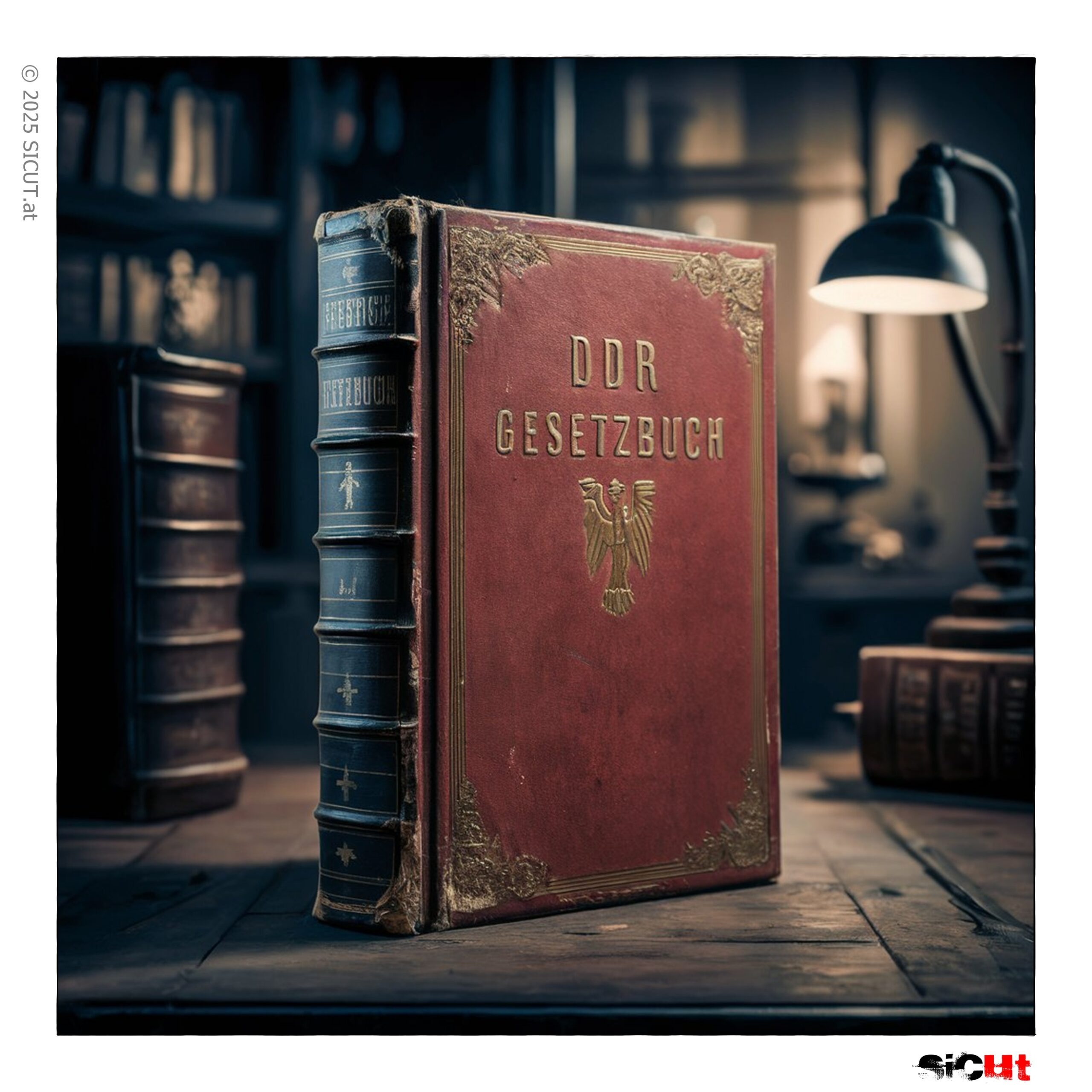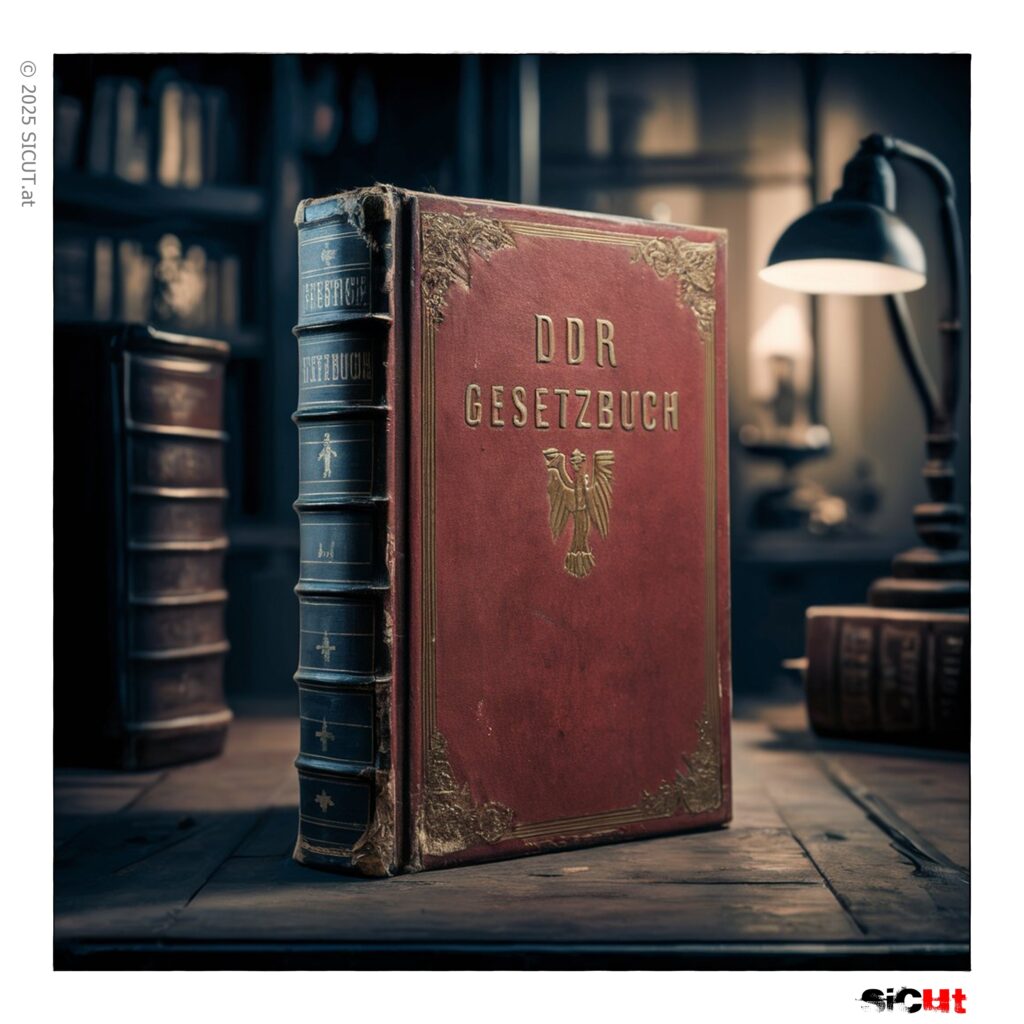
Die Frage, wer’s erfunden hat, klingt in unseren Ohren längst nicht mehr wie die neckische Pointe einer Halsschmerzpastillen-Werbung, sondern vielmehr wie das zynisch-historische Rätsel, das über jeder aktuellen Debatte schwebt wie ein müder Wetterballon über einem ausgebrannten Talkshowstudio. In einem Land, dessen moralische Seismographen bei jedem „falschen“ Tweet Amok laufen, wird die Ursprungsfrage zur heiligen Inquisition der Gegenwart: Wer hat zuerst gehetzt? Wer hat zuerst diffamiert? Wer hat begonnen, mit dem moralisch aufgeladenen Flammenwerfer durch die demokratische Landschaft zu pflügen? Die Antwort liegt – wie immer – irgendwo zwischen den Zeilen, zwischen den Gesetzesbüchern, zwischen der selektiven Empörung der jeweiligen Lager, also genau dort, wo sich Wahrheit am liebsten verkriecht: im Schatten der Lauten.
Der zitierte Paragraph, aus dem sich wie aus einer Verfassungspastille die moralische Pflicht zur permanenten Zivilcourage saugen lässt, formuliert es mit der Klarheit eines chirurgischen Schnitts: „Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen, Mordhetze gegen demokratische Politiker, Bekundung von Glaubens-, Rassen-, Völkerhass, militärische Propaganda sowie Kriegshetze und alle sonstigen Handlungen, die sich gegen die Gleichberechtigung richten, sind Verbrechen
im Sinne des Strafgesetzbuch.“ 1
Punkt.
Unmissverständlich.
Unstrittig.
Und dennoch: nie war es einfacher, mit genau diesen Begriffen um sich zu werfen, wie ein Pubertierender mit unpassenden Fremdwörtern. Wer heute von „Boykotthetze“ spricht, meint nicht selten einen empörten Tweet gegen die GEZ-Gebühren. Wer „Mordhetze“ ruft, hat womöglich eine satirische Karikatur nicht verstanden. Und „Rassenhass“? Ein dehnbarer Begriff, solange man selbst auf der richtigen Seite steht – also der moralisch überlegenen, selbstverliebt strahlenden Seite der Erleuchteten.
Wie der gute Zweck seine Abgründe offenbart
Es gehört zu den Ironien der postliberalen Demokratien, dass jene, die am lautesten „Wehret den Anfängen“ rufen, oft selbst den Anfang der nächsten Eskalationsstufe markieren. Wo früher Gesetze zum Schutz der Schwachen dienten, dienen sie heute nicht selten der Immunisierung der Lauten. Aus dem Schutzschild der Gleichberechtigung wurde ein Rammbock der Rechthaberei. Aus dem hehren Ideal der Demokratie ein Sprachregelungskatalog, durch den sich jede Abweichung in den Verdacht des Menschenhasses hineinziehen lässt.
Wer gegen das Gendern argumentiert, steht angeblich am Vorabend des Faschismus. Wer für einen differenzierten Blick auf Migration plädiert, rutscht schneller in den Verdacht des „strukturellen Rassismus“ als eine E-Mail in den Spamordner. Die Moralphalanx marschiert – und hinter ihr bleibt nicht etwa verbrannte Erde, sondern ein moralisch frischkompostiertes Feld voller Sprechverbote, Rücktrittsforderungen und Twittertribunalen.
Die ehemals bürgerliche Mitte? Von beiden Seiten beschossen. Die Linke sagt: Ihr habt zu lange geschwiegen. Die Rechte schreit: Ihr habt alles verraten. Und dazwischen sitzen die Letztverbliebenen, starren auf ihre Wahlzettel wie auf Sudoku-Felder voller Schuldgefühle, und fragen sich: Wer hat’s eigentlich erfunden, dass man in einer Demokratie nur noch mitschwimmen darf, wenn man dabei den richtigen Schwimmstil zeigt?
Von der Sprachpolizei zur Empörungsindustrie
Sprache ist Macht, sagte schon Foucault, und heute sagen das auch die Community Guidelines von Facebook. Was früher philosophisches Nachdenken war, ist heute Algorithmus: Inhalte werden sortiert, gelöscht, gewichtet, markiert – nicht mehr nach Wahrheitsgehalt, sondern nach emotionaler Verträglichkeit. Die Plattform entscheidet, was Hass ist. Die Redaktion entscheidet, was Hetze ist. Die „Zivilgesellschaft“ entscheidet, wer dazugehört. Der Rechtsstaat? Beobachtet derweil mit gerunzelter Stirn seine eigene Irrelevanz.
Denn „Hassrede“ ist heute das Gegenteil von Liebe zur Kontroverse. Sie ist das Etikett, das man über Argumente klebt, die man nicht hören will – oder nicht entkräften kann. Wer von offenen Grenzen spricht, ist mutig. Wer sie kritisiert, ist gefährlich. Wer soziale Gerechtigkeit fordert, ist engagiert. Wer Steuern kritisiert, ist neoliberal. Der moralische Bewertungsalgorithmus läuft rund um die Uhr – klimaneutral, aber meinungstödlich.
Dabei ist es kein Zufall, dass sich diese Form des hypermoralischen Aktivismus nicht in dunklen Kneipen, sondern in den Sitzungssälen von Stiftungen, NGOs und öffentlich-rechtlichen Redaktionen eingenistet hat. Die neue Zensur ist nicht mehr repressiv, sondern performativ. Sie zwingt niemanden zu schweigen – sie sorgt dafür, dass Schweigen das einzig Karriereförderliche bleibt.
Historisches Gedächtnis mit selektiver Lesebrille
Erinnerungspolitik ist das große Spielfeld der Selbstvergewisserung. Man bezieht sich auf Weimar, wenn man sich vor Populismus fürchtet. Auf 1933, wenn man politische Gegner diffamieren will. Und gerne auf 1945, um eigene Banalitäten in einen antifaschistischen Heiligenschein zu tauchen. Die Vergangenheit dient nicht mehr der Erkenntnis, sondern der Legitimation des Jetzt. Wer sich auf „Nie wieder“ beruft, sagt heute oft: „Nie wieder Meinungsvielfalt“.
Die Geschichte ist kein Mahnmal mehr, sondern ein Werkzeugkoffer.
Und wie bei jedem Werkzeugkoffer gilt: Wer nur einen Hammer hat, für den sieht jedes Argument aus wie ein Nazi.
Dabei war die Idee des Antifaschismus nie als Dauerzustand gedacht, sondern als Schutzwall gegen konkrete Gefahren. Heute aber hat sich dieser Wall in eine Burg verwandelt, in deren Innenhof sich Funktionäre und Berufsempörte gegenseitig versichern, dass draußen nur Barbaren lauern. Die Demokratie verteidigt sich tot, wenn sie vergisst, dass sie von Widerspruch lebt.
Schluss mit heilig – Zeit für Ironie
Und so kehren wir zurück zur Frage: Wer hat’s erfunden?
Die Boykotthetze? Die sprachliche Abrüstung der Gegenwart? Die inflationäre Empörung über alles, was nicht ins Weltbild passt? Die gezielte Moralisierung des Rechtsstaats?
Die Antwort lautet: alle. Jeder. Niemand. Der Zeitgeist. Die Algorithmen. Die Angst. Die Bequemlichkeit. Die Gier nach Deutungshoheit.
Und ja – auch wir selbst, wenn wir die Stirn runzeln und gleichzeitig schweigen.
Es ist Zeit, die moralische Kinnlade wieder zu schließen, das Denken zu entideologisieren – und vielleicht, ganz vielleicht, wieder zu lachen. Über uns selbst. Über das System. Über die Tatsache, dass man für diese Art von Essay bereits Applaus und Shitstorm zugleich erwarten darf.
Denn das ist das wahre Problem der Gegenwart:
Nicht der Hass.
Nicht die Hetze.
Sondern der völlige Verlust an Selbstironie.
1 DDR, Art. 6 Abs. 2 der Verfassung