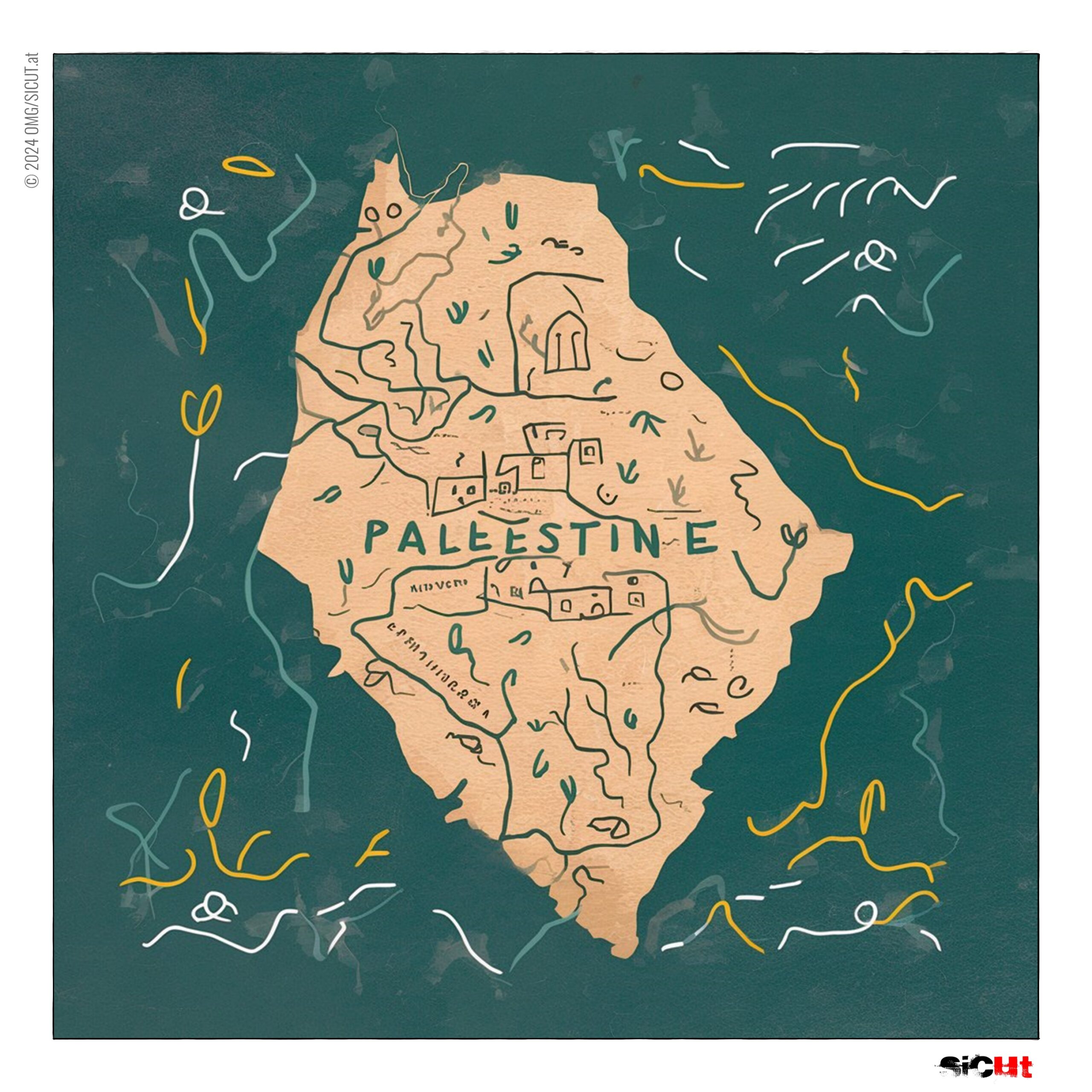Identität, Geschichtsklitterung und den schmalen Grat zwischen Realität und Fiktion
Die Geschichte ist oft ein schillerndes Spiel mit den Erzählungen, eine Art Theater, in dem die Protagonisten nicht immer die sind, die sie zu sein vorgeben. Und wenn es um das Thema Palästina geht, könnte man meinen, wir befänden uns in einer Aufführung des absurden Theaters, in der die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion immer mehr verschwommen. Die Frage „Gibt es Palästina?“ ist dabei nicht nur eine geografische oder politische, sondern vor allem eine identitätsstiftende Diskussion, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht – eine Geschichte, die oft von den Akteuren selbst neu geschrieben wird.
Die Erfindung einer Identität
Das Jahr 1967 markiert einen Wendepunkt in der Erzählung über Palästina. Der Sechs-Tage-Krieg brachte nicht nur eine militärische Niederlage für die arabischen Staaten, sondern auch eine Identitätskrise – oder vielleicht besser gesagt: eine Identitätserfindung. Vor diesem Konflikt war die Vorstellung eines „Palästinensers“ nicht nur nebulös, sie war praktisch nicht existent. Der Schriftsteller Walid Shoebat, ein einstiger Jordanier, fragt provokant: „Warum wurde ich über Nacht zum Palästinenser?“ Diese rhetorische Frage zeugt von der Absurdität der Geschichtsschreibung, in der die nationalen Zugehörigkeiten nicht nur relativ sind, sondern ganz nach Bedarf umgeschrieben werden können.
Die Konzeption eines palästinensischen Staates wird zunehmend als Werkzeug im fortgesetzten Kampf gegen Israel betrachtet. Dieser Kampf, der oft als legitimer Widerstand gegen die Besatzung deklariert wird, hat sich paradoxerweise in ein Narrativ verwandelt, das sich um das eigene Fehlen einer historischen Basis dreht. Die politische Bühne wird zur Kulisse für einen Identitätsdiebstahl, bei dem das Erbe der jüdischen Geschichte in ein palästinensisches Gewand gehüllt wird. So werden Kanaaniter und Jebusiter, die biblischen Völker, als „Urahnen“ der Palästinenser betrachtet, während die alte Geschichte der Region neu interpretiert wird, um ein imaginäres palästinensisches Narrativ zu stützen.
Ein absurder Vergleich
Es ist nicht nur das Geschichtsbewusstsein, das sich auf schillernde Weise wandelt, sondern auch die Erinnerungs- und Opferkultur. Die Nakba, das vermeintliche Trauma von 1948, wird grotesk in einen direkten Vergleich mit dem Holocaust gesetzt. Hier wird nicht nur das historische Leid der Juden verharmlost, sondern eine absurde Gleichsetzung hergestellt, die das Publikum schlichtweg verblüfft zurücklässt. Mahmud Abbas, der palästinensische Präsident, hat die Leugnung des Holocaust zu einem Kernpunkt seiner politischen Agenda gemacht und präsentiert die zionistischen Führer als „wesentliche Partner“ der Nazis.
Diese Kombination von Geschichtswissenschaft und politischem Opportunismus hat zu einer verstörenden Form der Geschichtsklitterung geführt. Die palästinensische Narrative, die von einer Katastrophe spricht, die den Arabern widerfahren sei, übersieht die Tatsache, dass dies in einem Kontext stattfand, in dem ein Vernichtungskrieg gegen die Juden geführt wurde – und verloren wurde. So entblößt sich die Absurdität, wenn man sieht, wie arabische Mädchen in Schulen lernen, ihre Notlage mit der von Anne Frank zu vergleichen.
Identität als Tauschhandel
Der Identitätsdiskurs wird im Lichte dieser historischen Konstrukte nur noch absurder. Ein Volk, das bis ins 20. Jahrhundert keine klare nationale Geschichte hatte, versucht nun, ein globales Publikum davon zu überzeugen, die rechtmäßigen Erben der jüdischen Geschichte und des jüdischen Landes zu sein. Die Verschiebung der Identität vom Jordanier zum Palästinenser ist nicht nur ein bloßer Zufall, sondern ein strategischer Schachzug im Spiel der internationalen Politik.
Ironischerweise bezieht sich sogar der Koran auf das Land Israel, das den „Kindern Israels“ als ewigen Bund gegeben wurde. In einem paradoxen Twist wird der Mord an Juden nicht erwähnt, während das Narrativ des palästinensischen Schmerzes und des Verlustes wie ein unaufhörlicher Strom aus der politischen Rhetorik fließt. Dara Horn hat es in ihrem Buch treffend auf den Punkt gebracht: „Die Menschen lieben tote Juden.“ Diese Aussage illustriert die düstere Ironie des Geschichtsdiskurses, in dem der Holocaust nicht nur verharmlost, sondern instrumentalisiert wird, um eine eigene Identität zu konstruieren.
Der schmale Grat zwischen Realität und Fiktion
Letztlich stehen wir vor der Frage: Was ist Realität, und was ist Fiktion in dieser Geschichtserzählung? Die palästinensische Identität ist ein Konstrukt, das mit einer Kombination aus historischer Revisionismus, politischem Opportunismus und der Kunst der Narrative kreiert wurde. Ohne eine solide historische Basis wird die Identität zu einem Spielball in den Händen derer, die das Geschichtsbewusstsein manipulieren.
Die Relevanz dieser Diskussion ist nicht nur akademischer Natur, sondern hat tiefgreifende Auswirkungen auf den politischen Diskurs und die internationale Politik. Während der Kampf um das Narrativ weiterhin tobt, bleibt die Frage nach der Identität der Palästinenser eine der brisantesten der modernen Geschichte. In dieser ständigen Neuschreibung der Geschichte sind wir alle Komplizen – ob wir es wollen oder nicht.
Die Unveränderlichkeit der Geschichte
So schließt sich der Kreis: In einer Welt, in der Identität, Geschichte und Politik untrennbar miteinander verwoben sind, bleibt die Erzählung von Palästina und den Palästinensern eine der komplexesten und umstrittensten Geschichten der Gegenwart. Und während die dramatischen Wendungen in der politischen Landschaft unaufhörlich weitergehen, wird das Publikum, gefangen zwischen Realität und Fiktion, zum ständigen Zeugen eines Theaters, in dem die Wahrheit ebenso flüchtig ist wie die Identität selbst.
Quellen und weiterführende Links
- Shoebat, Walid. Why I Am Not a Palestinian. New York: 2005.
- Muhsin, Zuhair. PLO’s Identity Politics. The Middle East Journal, 1980.
- Horn, Dara. People Love Dead Jews: Reports from a Haunted Present. New York: 2021.
- Abbas, Mahmud. Doktorarbeit zur Holocaustleugnung. 1980.
- Koran, Al-Baqarah (2:47).
- Historische Analysen zur Nakba und dem Holocaust.
Diese kritische Betrachtung der palästinensischen Identität und Geschichte erfordert ein offenes Ohr und eine Bereitschaft, sich mit den komplexen, oft schmerzhaften Realitäten der Region auseinanderzusetzen. In einer Welt, in der die Narrative oft mehr zählen als die Fakten, bleibt der diskursive Raum ein umkämpftes Terrain.