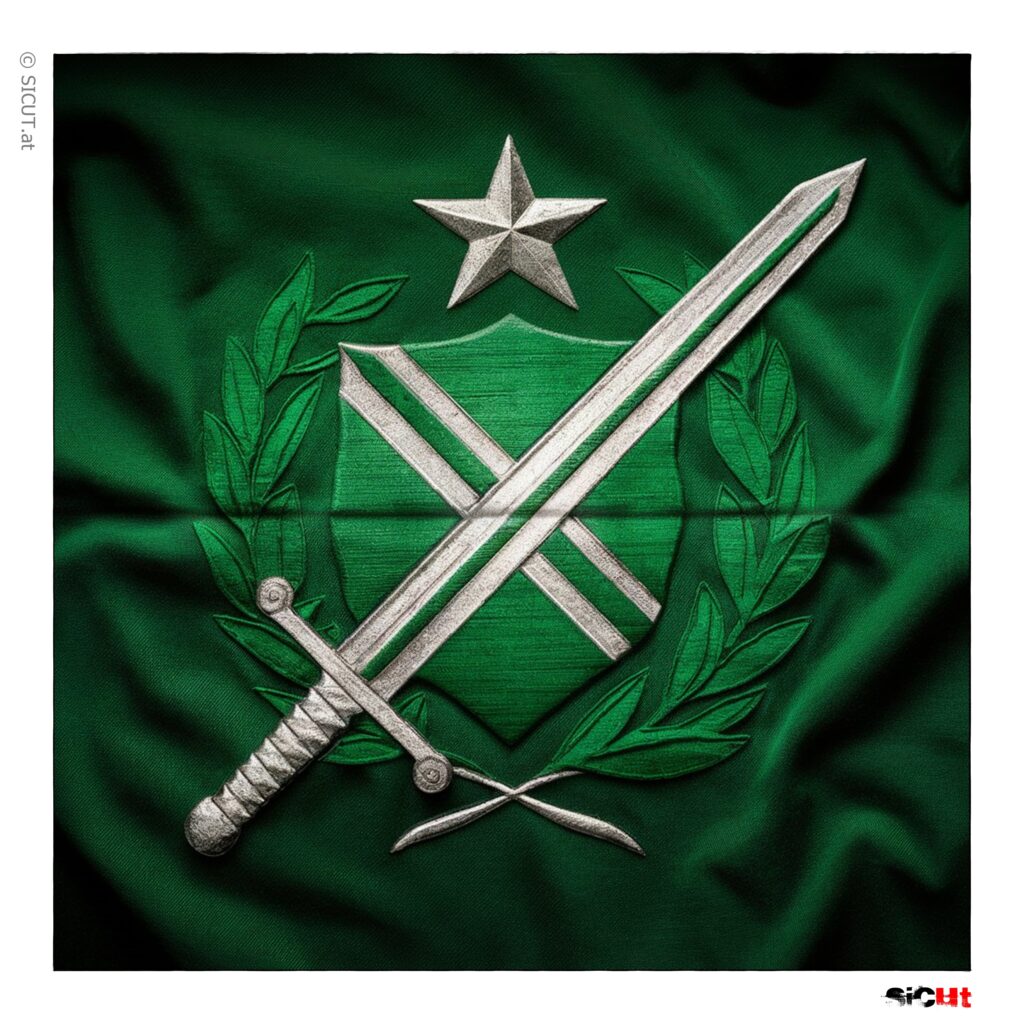
Die Liebe zum Menschen
Ah, die Liebe zum Menschen – was für eine noble Empfindung! Oder besser gesagt: was für ein strategisch unverzichtbares Werkzeug für alle, die sich in der hohen Kunst der politischen Selbstinszenierung üben. Ricarda Lang, ihres Zeichens Vorsitzende der Grünen, steht vor einem Mikrofon, und die Sätze, die sie formt, sind von einer Rhetorik durchdrungen, die irgendwo zwischen den erhabenen Höhen von Johann Wolfgang von Goethe und der aufgesetzten Emphase einer schlechten Instagram-Caption pendelt: „Wir machen Politik und ja, es klingt pathetisch, aber wir machen Politik aus Liebe zum Menschen.“
Man muss sich diesen Satz auf der Zunge zergehen lassen. Politik aus Liebe! Nicht aus Ideologie, nicht aus ökonomischen Interessen, und schon gar nicht aus dem banalen Streben nach Macht. Nein, es ist die Liebe! Eine Liebe, die sich scheinbar grenzenlos dehnt, irgendwo zwischen den Windparks Schleswig-Holsteins und den Radwegen in Berlin-Kreuzberg. Dabei schwingt Langs Erklärung mit einer fast rührenden Unschuld, als ob niemand auf die Idee kommen könnte, dass „Liebe“ in der Politik oft genauso echt ist wie die Tränen in einer Reality-TV-Show.
Doch Ricarda Lang steht nicht allein. Sie reiht sich ein in eine lange Tradition von Politiker:innen, die ihre Anliegen mit der schimmernden Rüstung der Menschenliebe verteidigen. Sie vergessen dabei, dass diese Liebe – wie jede andere auch – schnell zur Obsession werden kann. Oder, schlimmer noch, zur Farce.
Ein Liebender mit Aktenkoffern
Niemand hat die Absurdität politischer Menschenliebe je eindrucksvoller auf die Bühne gebracht als Erich Mielke, der letzte große Liebhaber des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Seine legendären Worte „Ich liebe – Ich liebe doch alle – alle Menschen – Na ich liebe doch – Ich setze mich doch dafür ein“ hätten auch als romantisches Geständnis durchgehen können, wären sie nicht aus dem Mund eines Mannes gekommen, der gleichzeitig ganze Wohnblöcke verwanzen ließ und den Nachbarn zum Spitzel machte.
Mielkes Liebesbekundung ist das groteske Spiegelbild einer politischen Kultur, in der „Liebe“ als rhetorisches Schwert geschwungen wird, während das Schild in der anderen Hand oft aus knallhartem Opportunismus besteht. Denn natürlich liebte Mielke nicht „alle Menschen“. Er liebte sie nur, solange sie ihm nützlich waren – oder solange sie keinen Antrag auf Ausreise aus der DDR stellten. Seine Liebe war wie ein schlecht programmierter Algorithmus: Sobald ein Mensch eine kritische Meinung äußerte, wurde die Liebe blitzschnell in Misstrauen konvertiert, und aus der Umarmung wurde eine Verhaftung.
Zwischen Pathos und Populismus
Warum aber ist die Liebe zum Menschen eine so häufig zitierte Floskel in der Politik? Die Antwort ist ebenso einfach wie ernüchternd: Sie ist ein unschlagbares Werkzeug, um moralische Überlegenheit zu demonstrieren. Wer aus Liebe handelt, der kann nicht falsch liegen. Oder?
Von Angela Merkel, die mit stoischer Gelassenheit ihre „Willkommenskultur“ erklärte, bis hin zu Populisten wie Donald Trump, die ihre Anhänger als die einzig „wahren Amerikaner“ lieben – der Appell an die Liebe wird immer dann laut, wenn die Argumente ausgehen. Die Liebe ist schließlich nicht nur ein Schwert, sondern auch ein Schild. Sie schützt vor Kritik, weil sie unangreifbar wirkt. Wer würde es wagen, jemandem zu widersprechen, der „aus Liebe zum Menschen“ handelt? Es ist ein Totschlagargument in Herzform.
Doch je häufiger es verwendet wird, desto mehr verblasst seine Kraft. Die inflationäre Liebe, die von Parteitagen, Wahlprogrammen und Talkshows tropft, verliert schnell ihren Zauber und wird zur Worthülse. Wenn plötzlich jede Partei von der AfD bis zur Linkspartei aus „Liebe zum Menschen“ handelt, fragt man sich unweigerlich: Wen lieben sie eigentlich genau?
Selektive Menschenliebe
Denn hier liegt die Crux: Die Liebe zum Menschen ist selten universal. Sie ist selektiv. Ricarda Lang liebt den Menschen – solange er auf dem Fahrrad unterwegs ist, biologisch abbaubare Verpackungen benutzt und mindestens eine Solaranlage auf seinem Dach stehen hat. Erich Mielke liebte den Menschen – solange er die DDR nicht verlassen wollte. Und so zieht sich durch die politische Landschaft ein Grundmuster: Die Liebe wird stets an Bedingungen geknüpft.
Der Mensch, den man liebt, ist immer der Mensch, der sich fügt. Der Mensch, der widerspricht, wird hingegen schnell zum Gegner. Die Grünen lieben Klimaschutzaktivisten, aber keine Dieselfahrer. Die FDP liebt Unternehmer, aber keine Steuerzahler, die den Sozialstaat fordern. Die AfD liebt „das Volk“, aber nur das, das ihre Definition von „deutsch“ erfüllt. Und so wird die Liebe zum Menschen zur kalten Taktik, ein Chamäleon, das sich den jeweiligen Parteifarben anpasst.
Pathetik als politisches Schmiermittel
Das eigentliche Problem ist jedoch nicht die Liebe selbst, sondern der Pathos, mit dem sie vorgetragen wird. Ricarda Langs pathetisches „Ja, es klingt pathetisch“ ist eine unfreiwillige Selbstparodie. Politiker:innen, die mit überbordendem Gefühl von ihrer Liebe zum Menschen sprechen, wirken schnell wie Schauspieler:innen in einem schlechten Drama – das Publikum sieht die Fäden, mit denen die Marionetten bewegt werden.
Der Pathos ist das Schmiermittel, das die Maschine der politischen Kommunikation am Laufen hält. Er lässt uns glauben, dass hinter jedem Gesetzesentwurf, jedem Koalitionsvertrag und jedem Steuerkonzept eine tiefe Menschlichkeit steckt. Doch was wir tatsächlich sehen, ist oft nichts weiter als die Mechanik eines Apparats, der auf Machterhalt ausgerichtet ist.
Ein Schlusswort mit einem Funken Hoffnung
Müssen wir uns also endgültig von der Liebe in der Politik verabschieden? Nicht unbedingt. Es wäre schön, wenn Politiker:innen die Liebe nicht nur als Rhetorik verwenden würden, sondern als echten Antrieb. Eine Liebe, die nicht selektiv ist, sondern universal. Eine Liebe, die nicht als Waffe dient, sondern als Brücke. Doch bis dahin bleibt uns wohl nur die Erkenntnis, dass politische Liebe oft nur ein Spiegel unserer eigenen Wünsche und Ängste ist – ein Spektakel, das wir mit einem skeptischen Lächeln betrachten sollten.
Denn am Ende lieben Politiker:innen vielleicht nicht die Menschen, sondern die Idee davon. Und vielleicht ist das auch genug.
