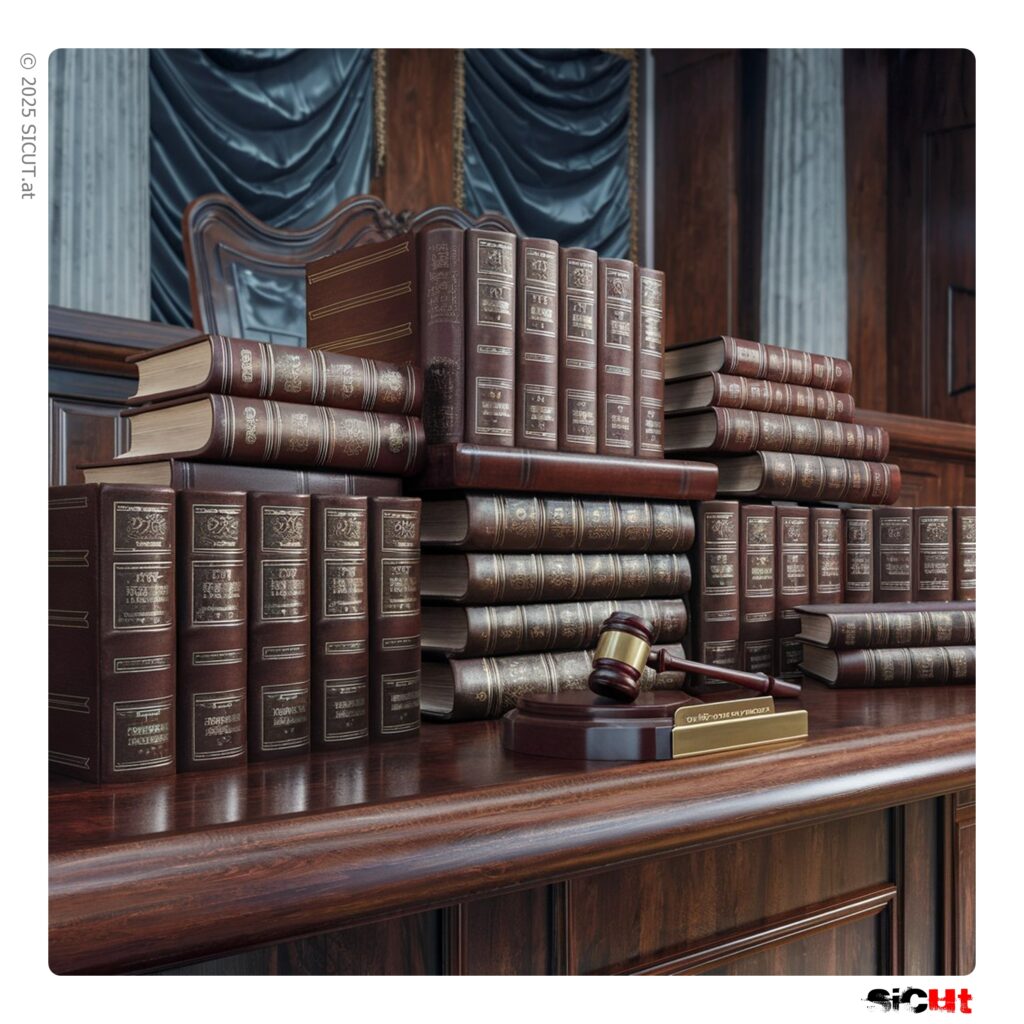
(1) Wer öffentlich gehässige, hetzerische oder von niedriger Gesinnung zeugende Äußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates, über ihre Anordnungen oder die von ihnen geschaffenen Einrichtungen macht, die geeignet sind, das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu untergraben, wird mit Gefängnis bestraft.
(2) Den öffentlichen Äußerungen stehen nichtöffentliche böswillige Äußerungen gleich, wenn der Täter damit rechnet oder damit rechnen muss, dass die Äußerung in die Öffentlichkeit dringen werde.
Das Problem, mit dem sich die Welt heute konfrontiert sieht, ist so alt wie die Menschheit selbst, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es in naher Zukunft verschwinden wird. Der Hass. Die Hetze. Die böswilligen Angriffe auf die politische Führung. Man könnte fast meinen, dass es sich dabei um einen unausweichlichen Bestandteil menschlicher Gesellschaften handelt, eine Krankheit, die nicht geheilt werden kann, sondern durch die Umstände, die uns umgeben, ständig am Leben erhalten wird. Doch das muss nicht so bleiben. Hier, meine Damen und Herren, ist der Vorschlag eines Gesetzes, das diese Krankheit zumindest auf der Ebene der legalen Anerkennung heilen könnte. Und wenn es wirklich gut läuft, vielleicht sogar in der ganzen Gesellschaft.
Warum dieses Gesetz? Warum jetzt?
Die Frage, warum ein solches Gesetz notwendig ist, ist schnell beantwortet: Wir leben in einem Zeitalter der Entmenschlichung. Der digitale Mob hat die Straßen der Diskussion erobert, und der Ruf nach dem Kopf der Politiker scheint in allen sozialen Netzwerken immer lauter zu werden. Die Dämonisierung von Staatsspitzen, die Beleidigungen derer, die das Schicksal einer Nation in der Hand halten, nehmen groteske Ausmaße an. Hat der Dichter nicht bereits im 18. Jahrhundert verkündet, dass „der Staat die größte Kunstform der Menschheit“ sei? Heutzutage wird der Staat als Vehikel für die persönliche Agitation gegen politische Gegner verstanden, als Zielscheibe für unreflektierte Hassbotschaften, die, einmal in die Welt gesetzt, wie bösartiger Mageninhalt durch den virtuellen Raum schwirren.
Doch, wie so oft, liegt das Übel im Detail. Diese Äußerungen sind nicht nur trivial. Sie sind von niederer Gesinnung, sie zeugen von einer tiefen Verachtung für die Institutionen und Persönlichkeiten, die unser Land zu führen berufen sind. Anstatt sich mit konstruktiver Kritik auseinanderzusetzen, werden sie Ziel öffentlicher und nichtöffentlicher Diffamierungen, die, wie der Vorschlag in §1 verdeutlicht, das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat untergraben.
Absatz (1): Eine Absage an das bösartige Zerrbild des Staates
Der erste Absatz des Gesetzes ist ein direkter Angriff auf die übliche Praxis, durch scharfe, spöttische und teils bösartige Bemerkungen über die Regierung und ihre Repräsentanten das Vertrauen in die politischen Strukturen zu zerstören. Der Wert dieser Institutionen wird durch solche Hetze beschädigt – und wenn man es genau nimmt, handelt es sich nicht nur um einen Angriff auf das Vertrauen, sondern um einen Anschlag auf die fundamentalen Prinzipien der Demokratie.
Denn: Wer hat sich nicht schon einmal über das Getuschel in den sozialen Netzwerken gewundert? Wer hat sich nicht gefragt, wie es möglich ist, dass der wichtigste Akteur einer Nation, der den Fortbestand von Frieden und Wohlstand sichert, wie ein missratener Theaterdirektor behandelt wird? Der Staatsmann oder die Staatsfrau wird von der Masse als unfähig, inkompetent oder gar als korrupt diffamiert, obwohl es keinerlei Grundlage für diese Anschuldigungen gibt – abgesehen von der eigenen, oft sehr begrenzten Sichtweise. Und hier liegt das Problem: Wir sind in eine Gesellschaft geraten, in der der Hass als legitimes politisches Instrument betrachtet wird.
Dieses Gesetz setzt da an. Es stellt klar, dass solche öffentlichen Äußerungen nicht nur unangebracht sind, sondern mit Gefängnis bestraft werden. Nicht, weil das Gesetz auf dem Grundsatz der Meinungsfreiheit fußt, sondern weil diese Meinungsäußerungen das Land an den Rand des Verfalls treiben. Es geht nicht mehr darum, sich an Fakten und Argumenten abzuarbeiten, sondern lediglich darum, zu hetzen, zu stigmatisieren und dabei der moralischen Integrität zu schaden. Dieses Gesetz ist eine Verteidigung des Staates gegen die Schwächung seiner Autorität durch unsachliche Hetze.
Absatz (2): Der virtuelle Dschungel der Privatsphäre und die öffentliche Verantwortung
Doch die Gesetze der modernen Welt hören nicht bei der reinen Öffentlichkeit auf. Wie wir alle wissen, gibt es keine „Privatsphäre“ mehr im digitalen Zeitalter. Die Gemälde von einst, in denen Menschen in ihren privaten Gemächern dargestellt wurden, gehören der Vergangenheit an. Heute können private Äußerungen über soziale Netzwerke genauso gefährlich sein, wie öffentliche – nicht, weil sie sich auf öffentliche Plattformen niederlassen, sondern weil sie die potenzielle Reichweite besitzen, sich dorthin auszubreiten. Was früher ein persönliches Gespräch zwischen zwei Menschen war, das in einem kleinen Raum verhallt, ist heute ein Brandbeschleuniger im Ozean der Informationsgesellschaft.
Der zweite Absatz des Gesetzes spricht genau diese Thematik an: Die „nichtöffentlichen“ böswilligen Äußerungen, die irgendwann in die Öffentlichkeit gelangen könnten. Eine vorsorgliche Regelung, die sicherstellt, dass auch die privaten Angriffe auf die Führung nicht ungestraft bleiben. Denn der digitale Raum kennt keine Grenzen – nicht geografisch und auch nicht gesellschaftlich. Die Worte eines einzelnen können, sei es in einem privaten Chat oder einem Tweet, eine Kettenreaktion auslösen, die das Bild des Staates in den Augen der breiten Masse verzerrt.
Hass als Populärsportart
In der heutigen Zeit ist das politische Geschäft zu einem Spektakel verkommen. Politiker sind zu Zirkusdirektoren geworden, die sich der konstanten, öffentlichen Aufmerksamkeit ausgesetzt sehen. Dabei wird der Hass zunehmend als eine Art Volkssport betrieben. Ein Sport, der so lange aufrechterhalten wird, bis die sozialen Medien wie eine riesige Arena wirken, in der Empörung als Unterhaltung verkauft wird. Der Hass ist die neue Währung, die die sozialen Medien mit dem von der Öffentlichkeit produzierten Treibstoff versorgen – je mehr Hass, desto mehr Klicks.
Doch dieser „Sport“ hat seine Schattenseite: Die Verrohung der Diskussion und die Zerstörung von Vertrauen sind keine Nebeneffekte, sondern die wahre, beabsichtigte Folge solcher Äußerungen. Die sogenannte „Meinungsfreiheit“ wird hier instrumentalisiert, um destruktive Angriffe auf den politischen Betrieb zu legitimieren, als ob Hass und Hetze die legitimen Ausdrucksformen einer aktiven Bürgerschaft wären.
Die Ironie des Gesetzes: Eine Gesellschaft, die den Hass braucht
Es gibt eine gewisse Ironie in der Tatsache, dass ein Gesetz gegen Hass und Hetze überhaupt notwendig geworden ist. Ironie ist in diesem Kontext nicht nur ein literarisches Stilmittel, sondern ein Spiegelbild der Gesellschaft, die dieses Gesetz erfordert. Die Tatsache, dass wir uns mit dieser Problematik auseinandersetzen müssen, sagt mehr über uns als Nation aus, als wir uns eingestehen wollen.
Was bedeutet es, wenn ein Gesetz eingeführt werden muss, das öffentliches Vertrauen durch Äußerungen von Hass und Hetze schützt? Ist dies der notwendige Schritt, um uns aus der Strudelspirale des moralischen Verfalls zu befreien, oder ist es ein weiterer, längst überfälliger Versuch, die Zügel zu straffen, um der Gesellschaft die nötige Orientierung zu geben?
Fazit: Der gesunde Menschenverstand als Maßstab
Am Ende ist der Vorschlag für ein Gesetz gegen Hass und Hetze ein klarer Aufruf zur Rückkehr zu einem politischen und gesellschaftlichen Diskurs, der durch Respekt, Fairness und letztlich auch durch den gesunden Menschenverstand geprägt ist. Wer sich in einer zivilisierten Gesellschaft bewegt, muss in der Lage sein, seine politischen Differenzen ohne die Verzerrung durch schädliche, polemische Angriffe auszutragen. Der Staat sollte nicht als Prügelknabe für die Frustrationen einer Kultur des Hasses dienen müssen.
Ein solcher Gesetzesvorschlag mag in der Praxis nicht vollkommen sein. Aber er ist ein notwendiger Anfang – ein Versuch, einen zerstörerischen Trend aufzuhalten, bevor die Zerstörung zu umfassend wird, um rückgängig gemacht zu werden. Und vielleicht, nur vielleicht, wird dies der Moment sein, in dem wir erkennen, dass die wahre Stärke einer Gesellschaft nicht in der Lautstärke des Hasses liegt, sondern in der Fähigkeit, ihn zu überwinden.
ANMERKUNG: In Absatz (1) wurde folgendes entfernt: „ … Persönlichkeiten des Staates, „oder der NSDAP“ über ihre Anordnungen …“, ansonsten ist der Gesetzestext wörtlich aus dem „Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen, vom 20. Dezember 1934“ übernommen.
