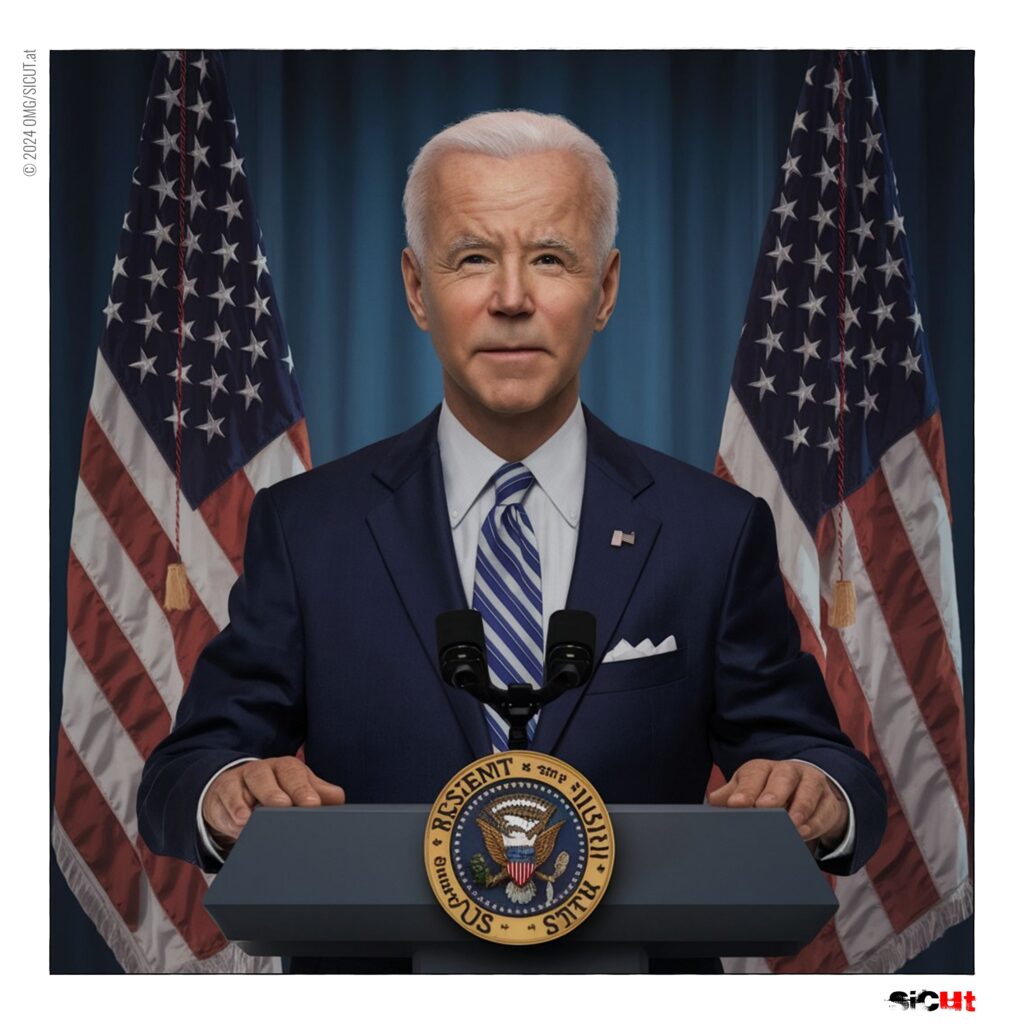
Joe Biden, Hunter und das politische Gedächtnis der USA
Ein milder Herbsttag in Washington D.C., die Blätter färben sich golden, und während sich die amerikanische Öffentlichkeit auf den Konsum von Pumpkin-Spiced-Latte vorbereitet, liefert das Weiße Haus eine Nachricht, die wie ein Blitz einschlägt: Präsident Joe Biden begnadigt seinen Sohn Hunter. Ja, den Hunter Biden, dessen Name so oft in denselben Sätzen wie „Laptop“, „Ukraine“ oder „Steuerhinterziehung“ auftaucht, dass man meinen könnte, er wäre ein Synonym für alles, was konservative Kommentatoren an der politischen Elite verachten.
Es ist, als hätte Biden selbst vergessen, dass er über Jahre hinweg beteuert hat, niemals – wirklich niemals – eine Begnadigung seines Sprösslings in Betracht zu ziehen. Doch wie bei einem alten Mann, der seine Lesebrille sucht, scheint die Erinnerung daran in der hintersten Schublade des präsidialen Gedächtnisses verschwunden zu sein. Und während Demokraten bemüht sind, das Ganze als „humanitären Akt“ zu verteidigen, brüllt der rechtskonservative Mediensumpf bereits: „Stellt euch vor, Trump hätte das getan!“ Aber lassen wir diese Vorstellung kurz wirken: Was wäre, wenn Trump Eric oder Don Jr. aus der rechtlichen Schlinge gezogen hätte?
Die doppelte Moral
Wäre Trump in derselben Lage gewesen, hätten sich die politischen Kommentatoren in einer Mischung aus Entrüstung und schadenfrohem Grinsen überschlagen. CNN hätte ein 24/7-Live-Ticker-Spektakel gestartet: „BREAKING: TRUMP ZEIGT, WIE KORRUPT DIE USA SIND.“ Twitter wäre explodiert, und George Clooney hätte spontan ein Spenden-Dinner für die Demokratie veranstaltet. Aber jetzt? Jetzt versucht man, uns weißzumachen, dass Hunters Begnadigung nicht nur rechtlich korrekt, sondern auch moralisch einwandfrei sei – ein wahrer Akt väterlicher Gnade.
Man stelle sich vor, Trump hätte Eric vor einer langen Haftstrafe gerettet. Die Demokraten hätten ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet, bevor die Tinte auf dem Begnadigungsdekret trocken gewesen wäre. Doch Joe Biden bleibt weitgehend verschont. Denn es ist nicht nur das amerikanische Justizsystem, das mit zweierlei Maß misst, sondern auch der öffentliche Diskurs.
Helden, die keine Gnade finden
Während Hunter Biden auf den Stufen des Weißen Hauses ein Lächeln aufsetzt, das irgendwo zwischen Erleichterung und „ich habe es ja gewusst“ liegt, gibt es zwei Männer, die diese Szene mit bitterem Nachgeschmack verfolgen dürften: Julian Assange und Edward Snowden. Beide haben, ob man sie nun mag oder nicht, etwas getan, was Hunter nie in Betracht gezogen hätte – sie haben Geheimnisse ans Licht gebracht, die den amerikanischen Staat in seinem Kern erschüttert haben. Assange sitzt weiterhin in einem Londoner Gefängnis und wartet auf seine mögliche Auslieferung, während Snowden in Russland festsitzt, einem Land, das mittlerweile selbst ein Symbol für den Verrat an Transparenz und Freiheit geworden ist.
Dass Biden sich weigert, diesen beiden Männern auch nur einen Hauch von Gnade zu gewähren, ist ein Statement. Es zeigt, dass der amerikanische Präsident sehr wohl Prioritäten setzen kann, wenn es um Begnadigungen geht. Hunter Biden, der laut Anklage ein Leben im Schatten moralischer Fragwürdigkeit führte, verdient in Bidens Augen offenbar mehr Mitgefühl als jene, die es wagten, den Staat zur Rechenschaft zu ziehen.
Eine Nation der Amnesie
Man könnte meinen, dass Joe Bidens Entscheidung, seinen Sohn zu begnadigen, politischer Selbstmord wäre. Aber in einer Zeit, in der die Aufmerksamkeitsspanne des Durchschnittsbürgers kaum länger als ein TikTok-Video ist, scheint das Risiko überschaubar. Schließlich wird die Geschichte in ein paar Wochen wieder vergessen sein, wenn die nächste politische Bombe platzt. Vielleicht ist das der eigentliche Trick: Bidens Team weiß, dass die Menschen einfach vergessen werden. Und so setzt der Präsident auf das kurzlebige Gedächtnis einer Gesellschaft, die lieber über den neuesten Netflix-Hit diskutiert als über die ethischen Implikationen eines präsidialen Begnadigungsakts.
Doch es bleibt ein fader Beigeschmack. Das Versprechen von Transparenz und Integrität, das Biden einst zu seinem politischen Markenzeichen machte, liegt nun in Trümmern. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass selbst die moralischen Grundsätze eines angeblich ehrenhaften Politikers dem Druck familiärer Bindungen nicht standhalten können.
Ein hypothetisches Szenario
Lassen Sie uns noch einmal zur Frage zurückkehren, wie die Welt reagiert hätte, wenn Trump in der gleichen Situation gewesen wäre. Der ehemalige Präsident hätte sich vermutlich keine Mühe gemacht, seine Entscheidung zu rechtfertigen. „Eric ist ein großartiger Typ. Er hat nichts falsch gemacht. Die Hexenjagd ist vorbei“, hätte Trump auf einer seiner berüchtigten Kundgebungen verkündet, während MAGA-Hüte durch die Luft flogen. Die Medien hätten ihn in Stücke gerissen, und Late-Night-Hosts hätten monatelang genug Material für ihre Monologe gehabt.
Aber ist Bidens Entscheidung wirklich weniger fragwürdig, nur weil sie leiser, höflicher und mit dem Hauch einer Entschuldigung daherkommt? Wohl kaum. Was hier auf dem Spiel steht, ist nicht nur das Vertrauen in die Unparteilichkeit des Präsidenten, sondern auch die Glaubwürdigkeit des gesamten Justizsystems.
Eine Begnadigung, die Fragen aufwirft
Hunter Bidens Begnadigung ist ein Symbol für alles, was in der amerikanischen Politik falsch läuft: Doppelmoral, Vetternwirtschaft und die schamlose Ausnutzung des politischen Amnesie-Effekts. Während Assange und Snowden weiterhin als Verräter gebrandmarkt werden und ihre Freiheit opfern, zeigt Biden, dass persönliche Loyalität immer noch mehr Gewicht hat als moralische Konsequenz.
Die Frage bleibt: Werden die Amerikaner diese Entscheidung ebenso schnell vergessen, wie sie die zahlreichen Skandale der letzten Jahre vergessen haben? Oder wird dies der Moment sein, in dem die Menschen erkennen, dass die Integrität eines Präsidenten nicht nur an seinen Worten, sondern vor allem an seinen Taten gemessen werden muss?
Quellen und weiterführende Links
- The White House: „Presidential Pardons Explained“ – Hintergrund zur Begnadigungspraxis in den USA.
- The Guardian: „Julian Assange: The Man Behind the Whistleblower“.
- New York Times: „Hunter Biden’s Legal Troubles: What We Know“.
- Edward Snowden: Permanent Record. Buch über seine Enthüllungen und das Leben im Exil.
- Politico: „Biden’s Pardons: A Closer Look at Presidential Mercy“.
